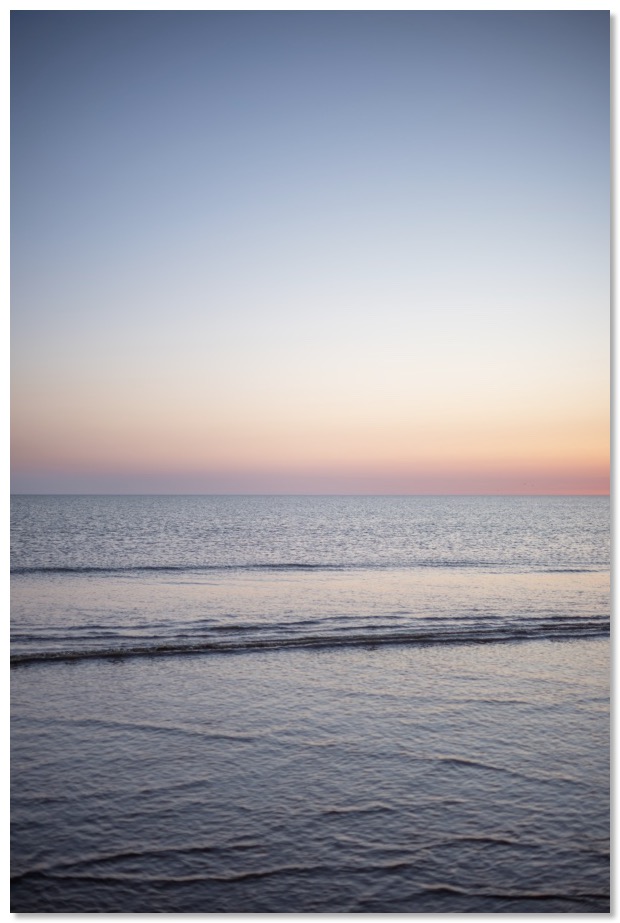Form und Leere
20.10.2024
Noch immer erfreuen wir uns in unserer Sangha am Studium des Herzsutras:
...“Oh, Shariputra, Form ist nichts anderes als Leere, Leere nichts anderes als Form. Form ist Leere; Leere ist Form. So ist es mit Empfindung, Wahrnehmung, Wollen und Unterscheiden“.
Hier listet Shariputra die fünf Aspekte der menschlichen Existenz auf (skandhas), die im Deutschen auch mit „Aggregaten“ oder „Daseinsgruppen“ übersetzt werden.
Zweifelsohne haben wir eine bestimmte Gestalt, eine Form. Wir haben Empfindungen, wir geben unseren Wahrnehmungen einen Namen. Wir streben nach bestimmten Dingen und Aspekten. Wir sind in der Lage, Zusammenhänge, die sich unserer direkten Wahrnehmung entziehen, voneinander zu entscheiden. Wir bilden bestimmte Werte aus, wir formen eine innere Haltung.
Was daran ist „leer“?
Diese Leerheit ist keine keimfreie Ödnis. Sie ist auch nicht ohne „etwas“. Sie ist nur frei von etwas. Einem unveränderbaren Kern, zum Beispiel.
Von außen betrachtet, ist unser Gefühlsmodus vielleicht meistens gleich. Wir stehen auf, machen uns fertig, gehen zur Arbeit, telefonieren, sprechen mit vielen Menschen, freuen uns auf dem Nachhauseweg an der Herbstfärbung oder auf den Feierabend.
Ein normaler Tag.
Wenn wir aber still werden, so leise wie im Zazen, dann können wir unsere jeweilige Klangfarbe oft ganz anders erleben als im Rauschen der vielen Handgriffe, die nun einmal unseren Alltag formen. Vielleicht überkommt uns eine burgundfarbene Melancholie oder ein ungeahntes Ausmaß an Schwermut. Vielleicht auch eine unbändige Freude. Dies geschieht einfach, es ist plötzlich da, kommt aus der Stille wie der Mond hinter den Wolken. Ohne dass wir beide Empfindungen mit einem Anlass in Zusammenhang bringen können. Sie verweilen etwas bei uns, wir schwingen mit – und dann verklingen sie. Wenn wir noch stiller werden, stellen wir fest, dass diese Klangfarben in nur einer Meditationseinheit eng beieinander liegen können. Dann geht der Gong und wir sind wieder „ich“. So wie „immer“. Wirklich?
In Wahrheit sind wir nie gleich, weder als Form, Empfindung, Wahrnehmung, Wollen noch Unterscheiden.
Wir sind auch nicht einmal „leer“ und einmal „reich an allem, was es gibt“. Wir verfehlen Shunyata, wenn wir den Theorien Glauben schenken (und derer gibt es einige), dass wir danach streben sollten, „leer“ von irgendetwas zu sein, am besten von uns selbst. Dies würde bedeuten, dass wir an der geistigen Landkarte der Wirklichkeit festhalten und das Konzept der Leerheit darüberlegen. Einer Leere, die oft eine negative Konnotation aufweist.
Es ist nicht: ich hier, als (armselige) Gestalt. Das zu Erstrebende dort, als Nicht-Sein. Wir hier im Jammertal der Dinge und Formen. Die wenigen Auserwählten dort, im Himmelblau des Absoluten.
Kurz bevor Zen Meister Ninakawa starb, besuchte ihn Zen Meister Ikkyu.
„Soll ich Dich anleiten?“ fragte Ikkyu.
Ninakawa antwortete: „Allein kam ich her. Allein gehe ich. Welche Hilfe könntest Du mir geben?“
Ikkyu antwortete: „Wenn Du denkst, dass Du wirklich kommst und gehst, ist dies Deine Verblendung. Erlaube mir, Dir den Pfad zu zeigen, auf dem es weder Kommen noch Gehen gibt.“
Mit diesen Worten zeigte Ikkyu den Weg so klar, dass Ninakawa lächelte und verschied.
...“Oh, Shariputra, Form ist nichts anderes als Leere, Leere nichts anderes als Form. Form ist Leere; Leere ist Form. So ist es mit Empfindung, Wahrnehmung, Wollen und Unterscheiden“.
Hier listet Shariputra die fünf Aspekte der menschlichen Existenz auf (skandhas), die im Deutschen auch mit „Aggregaten“ oder „Daseinsgruppen“ übersetzt werden.
Zweifelsohne haben wir eine bestimmte Gestalt, eine Form. Wir haben Empfindungen, wir geben unseren Wahrnehmungen einen Namen. Wir streben nach bestimmten Dingen und Aspekten. Wir sind in der Lage, Zusammenhänge, die sich unserer direkten Wahrnehmung entziehen, voneinander zu entscheiden. Wir bilden bestimmte Werte aus, wir formen eine innere Haltung.
Was daran ist „leer“?
Diese Leerheit ist keine keimfreie Ödnis. Sie ist auch nicht ohne „etwas“. Sie ist nur frei von etwas. Einem unveränderbaren Kern, zum Beispiel.
Von außen betrachtet, ist unser Gefühlsmodus vielleicht meistens gleich. Wir stehen auf, machen uns fertig, gehen zur Arbeit, telefonieren, sprechen mit vielen Menschen, freuen uns auf dem Nachhauseweg an der Herbstfärbung oder auf den Feierabend.
Ein normaler Tag.
Wenn wir aber still werden, so leise wie im Zazen, dann können wir unsere jeweilige Klangfarbe oft ganz anders erleben als im Rauschen der vielen Handgriffe, die nun einmal unseren Alltag formen. Vielleicht überkommt uns eine burgundfarbene Melancholie oder ein ungeahntes Ausmaß an Schwermut. Vielleicht auch eine unbändige Freude. Dies geschieht einfach, es ist plötzlich da, kommt aus der Stille wie der Mond hinter den Wolken. Ohne dass wir beide Empfindungen mit einem Anlass in Zusammenhang bringen können. Sie verweilen etwas bei uns, wir schwingen mit – und dann verklingen sie. Wenn wir noch stiller werden, stellen wir fest, dass diese Klangfarben in nur einer Meditationseinheit eng beieinander liegen können. Dann geht der Gong und wir sind wieder „ich“. So wie „immer“. Wirklich?
In Wahrheit sind wir nie gleich, weder als Form, Empfindung, Wahrnehmung, Wollen noch Unterscheiden.
Wir sind auch nicht einmal „leer“ und einmal „reich an allem, was es gibt“. Wir verfehlen Shunyata, wenn wir den Theorien Glauben schenken (und derer gibt es einige), dass wir danach streben sollten, „leer“ von irgendetwas zu sein, am besten von uns selbst. Dies würde bedeuten, dass wir an der geistigen Landkarte der Wirklichkeit festhalten und das Konzept der Leerheit darüberlegen. Einer Leere, die oft eine negative Konnotation aufweist.
Es ist nicht: ich hier, als (armselige) Gestalt. Das zu Erstrebende dort, als Nicht-Sein. Wir hier im Jammertal der Dinge und Formen. Die wenigen Auserwählten dort, im Himmelblau des Absoluten.
Kurz bevor Zen Meister Ninakawa starb, besuchte ihn Zen Meister Ikkyu.
„Soll ich Dich anleiten?“ fragte Ikkyu.
Ninakawa antwortete: „Allein kam ich her. Allein gehe ich. Welche Hilfe könntest Du mir geben?“
Ikkyu antwortete: „Wenn Du denkst, dass Du wirklich kommst und gehst, ist dies Deine Verblendung. Erlaube mir, Dir den Pfad zu zeigen, auf dem es weder Kommen noch Gehen gibt.“
Mit diesen Worten zeigte Ikkyu den Weg so klar, dass Ninakawa lächelte und verschied.